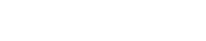Beim diesjährigen Journalistentag Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) hat der Berliner Publizistikwissenschaftler Prof. Stephan Ruß-Mohl ein kritisches Referat zum Verhältnis von PR und Journalismus gehalten. Verbändereport dokumentiert das Referat auszugsweise.

In den meisten Ländern Europas wächst der PR-Sektor schneller als der Journalismus. Allerorten werden PR-Abteilungen ausgebaut und hochgerüstet. Imagepflege lassen sich Unternehmen und Behörden, Parteien und Nicht-Regierungsorganisationen eine Menge kosten.
Zwar sind auch die Medien selbst und nicht nur deren Zulieferer eine Wachstumsbranche. Immer mehr Redaktionen konkurrieren um Leser, Hörer und Zuschauer. Die einzelnen Redaktionen sind dabei jedoch vielerorts Opfer des Lean Managements geworden, soll heißen: Sie werden ausgedünnt.
PR-Aufrüstung vs. leere Redaktionsstuben
Der "Aufrüstung" im PR-Sektor steht also keine gleichwertige Ausweitung journalistischer Recherchekapazität gegenüber. Die aufs eigentliche Nachrichtengeschäft spezialisierten Medienbetriebe können mit dem Investment in PR nicht mithalten. Selbst solche Häuser tun sich dabei schwer, die Wert auf die journalistische Qualität ihrer Produkte legen und ihre Zeitungen und Rundfunkstationen nicht einfach als Goldesel betrachten, die nur für die Anteilseigner Gewinn abwerfen sollen.
Oftmals werden journalistische Leistungen outgessourst - zu Konditionen, die für freie Journalisten, die diese Leistungen dann erbringen sollen, bedeuten, dass sie kaum noch Zeit für Recherchen aufbringen können und vermehrt Zulieferungen aus der PR-Branche nutzen - ja oft sogar auf ein Zubrot von dort angewiesen sind, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
USA als Trendsetter
In den Vereinigten Staaten haben Öffentlichkeitsarbeiter die Journalisten auch zahlenmäßig seit langem überflügelt. In den USA gab es bereits zu Beginn der 90er Jahre schätzungsweise 162.000 PR-Praktiker, aber - einer allerdings konservativen Schätzung zufolge - nur 122.000 Journalisten. Die PR-Leute vermehren sich auch weiterhin schneller als die Journalisten; im Jahr 2000 sollen es bereits 197.000 sein.
Noch größer wird das Gefälle zwischen PR und Journalismus, wenn man Ausbildungsniveau, Berufserfahrung und Gehälter miteinander vergleicht. Oft wechseln ja gerade erfahrene Journalisten in die PR-Branche über. In den USA ist der Anreiz, dies zu tun, noch größer, denn Journalisten verdienen - bis auf wenige TV-Starreporter und Anchors - deutlich schlechter als in den meisten Ländern Westeuropas. Auch das infrastrukturelle Netzwerk, das die Professionalisierung in der PR-Branche vorantreibt, ist in den USA feinmaschiger. Eigene Studiengänge oder -schwerpunkte, PR-Forschung und PR-Fachzeitschriften, fachöffentliche Diskussionsforen - all das hat in Amerika bereits Tradition, während es sich bei uns in Europa erst allmählich entwickelt.
Ebenfalls aus den USA zu uns herübergeschwabbt ist die Diskussion um excellence in pr - und damit einhergehend der Diskurs um Qualitätsstandards und Erfolgsmessung in der Öffentlichkeitsarbeit. In Amerika wird diese Diskussion allerdings auch von einer Fachdiskussion um excellence in journalism begleitet. In Deutschland und in Europa hat diese Journalismus bezogene Qualitäts-Diskussion dagegen die akademischen Fachzirkel noch kaum verlassen; sie hinkt deutlich hinter dem Diskussionsstand und dem Dialog zwischen Theorie und Praxis im PR-Bereich hinterher.
Neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit, die in den USA praktiziert werden, sind allerdings inzwischen auch in Europa angekommen. Dazu zwei Beispiele, die in jüngster Zeit praxiswirksam geworden sind:
Spin doctoring ...
Im Wahlkampf zum Britischen Unterhaus und auch im deutschen Bundestagswahlkampf 1998 war viel von spin doctoring die Rede. Offenbar können das inzwischen nicht nur die Manager von Bill Clinton, sondern auch die Berater der "Modernisierungsexperten" Tony Blair und Gerhard Schröder.
Amerikanische Insider berichten, letztes Ziel der PR-Strategen in einer Wahlkampagne sei "die völlige Kontrolle der Kommunikation". Spin doctors sind Strategen, die einen Krieg führen und gewinnen wollen. Spin doctors sind allerdings nicht nur Strategen, sondern oftmals auch zwielichtige Leute, die sich im Bedarfsfall schmuddeliger Methoden bedienen.
... and whistle blowing
Das zweite Beispiel zeigt: Gelegentlich gibt es auch Versuche gezielter Medienkritik von Seiten der PR. Solches whistle blowing im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung hat in den USA inzwischen eine langjährige Tradition. In Deutschland erregt dagegen sogenannte Advertorials - eine Wortschöpfung, wie advertising und editorial, also Anzeige und Kommentar kombiniert - erst in jüngster Zeit mehrfach Aufsehen. Prinz Ernst August und Caroline von Monaco schalteten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ganzseitig einen offenen Brief an Hubert Burda, um den Schmuddeljournalismus der BUNTEN anzuprangern. Mit einem weiteren solchen Advertorial verbreitete der Prinz seine Version über den Hergang der Schlägerei vor seinem Feriensitz in Afrika. In einer ebenfalls ganzseitigen Wahlanzeige setzte sich die Initiative Pro-DM mit der Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auseinander.
PR beschränkt sich also nicht mehr nur auf das spinning und auf das spoonfeeding - so nennen die Amerikaner das Abfüttern der Medien mit Informationen. PR beobachtet, begleitet und kontrolliert den Journalismus auch auf mehr oder minder subtile Weise.
PR und Journalismus: eine Einbahnstraße ?
Zusammengenommen deuten diese und andere Entwicklungen darauf hin, dass sich der Einfluss von Seiten der Öffentlichkeitsarbeit auf den Journalismus weiter vermehrt - jedenfalls eher als umgekehrt. Im Regelfall agieren die PR-Leute weiter als "geheime Verführer", deren Kunst darin besteht, dem Journalismus unabweisbare Angebote zu machen. In Einzelfällen mag es statt des Zuckerbrotes auch die Peitsche geben - geharnischte Kritik, um die Medien in die Schranken zu verweisen. Dies ist allerdings eher die Ausnahme von der Regel.
Was die Wissenschaftler modellieren: das Baern’sche Theorem
Angesichts solcher Trends verwundert es ein wenig, wenn die wissenschaftliche Diskussion um den Einfluss von PR sich in Deutschland eher gegenläufig zu entwickeln scheint. So verstehe ich jedenfalls die aktuelle Diskussion um Intereffikation. Ausgangspunkt des Diskurses um die Macht von PR war eine Studie von Barbara Baerns von 1985. Sie fragte nach dem Einfluss, den Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit beim Entstehen von Medieninhalten haben und konstatierte - ceteris paribus - "eine gegenseitige Abhängigkeit". Je mehr "Einfluss Öffentlichkeitsarbeit ausübt, um so weniger Einfluss kommt Journalismus zu und umgekehrt". Die Machtverteilung zwischen Journalismus und PR wird in diesem Denkmodell also zum Nullsummenspiel.
Aufbauend auf diesem Denkansatz gelangte Baerns zu dem Ergebnis, dass Öffentlichkeitsarbeit Themen und Timing der Medienberichterstattung weitgehend kontrolliert: Ca. Zweidrittel aller Meldungen, die von den Medien verbreitet werden, stammen aus Pressestellen und PR-Agenturen.
Das Baernssche Modell hat jedoch Schwachstellen: Es fußt auf der Prämisse, dass PR-Leute "Selbstdarstellung partikulare Interessen durch Information" betreiben. Im Klartext: Sie verfolgen die Eigeninteressen ihrer Auftraggeber. Journalismus wird dagegen als "Fremddarstellung und .... als Funktion des Gesamtinteresses" gesehen. Journalisten sind also so etwas die hehren Vertreter des Allgemeinwohls. Das hat m. E. nie gestimmt, aber so, wie sich die kommerzialisierten Mediensysteme und der Journalismus derzeit in den USA und in Europa entwickeln, stimmt es weniger denn ja - es sei dann, man glaubt, was gut für Bertelsmann, Kirch und Springer ist, müsse auch gut für die Allgemeinheit sein.
Bei Baerns Modell handelt es sich um ein geschlossenes System: Es lässt die Möglichkeit nicht zu, dass beide Seiten, also PR-Leute und Journalisten, beispielsweise durch symbiotisches Verhalten gemeinsam ihre Macht steigern.
Die Kritiker der Baernsschen Determinationsthese, der zur Folge PR den Journalismus weitgehend kontrolliert, unterstreichen außerdem die Steuerungsleistung des Journalismus. Den Einfluss von PR suchen sie mit folgenden Argumenten zu relativieren:
Um erfolgreich zu sein, müssen PR-Leute sich erst einmal an Nachrichtenfaktoren orientieren. Somit gibt das Mediensystem und der Journalismus vor, was thematisiert werden kann und was nicht. Nicht das Mediensystem wird politisiert und PR-gesteuert, sondern Politik und PR werden mediatisiert. Im Krisenfall hat PR außerdem kaum noch Erfolgschancen. Dies haben vor allem Henrike Barth und Wolfgang Donsbach herausgearbeitet: In solchen Fällen verselbständigt sich Journalismus, er funktioniert autonom von der sonst üblichen Abfütterung.
Sozusagen als Synthese, die auf These und Antithese folgt, werden seit geraumer Zeit in der deutschen Fachdiskussion die sogenannte Intereffikations-Modelle präsentiert. Demzufolge sind Journalismus und PR aufeinander angewiesen und ermöglichen sich gegenseitig.
Die Theorie des by-passing
Es gibt im wachsenden Umfang PR-Arbeit, die ihre Zielgruppen am Journalismus vorbei zu erreichen versucht, also das sogenannte by-passing. Gelegentlich, allerdings wohl eher schwindend und mit abnehmender Erfolgschance, versucht sich umgekehrt auch Journalismus durch gründlichere eigene Recherche PR-unabhängig zu konstituieren - auch das übrigens eine Form des by-passing, allerdings eben vorbei an den Pressestellen und nicht an den Redaktionen. Beim Blick von Deutschland aus auf die USA wird im übrigen der Stellenwert dieses investigativen Journalismus oft maßlos überschätzt, denn auch in Amerika ist er eher die Ausnahme als die Regel. Für den Bestand der Demokratie ist es indessen auch nicht essentiell, dass dies allzu häufig passiert, wichtig ist, dass es jederzeit passieren kann und dass die jeweiligen Machthaber solche Investigationen fürchten wie der Teufel das Weihwasser.
Tritt die vierte Gewalt in zweierlei Gestalt auf?
Gleichwohl scheint mir die Diagnose heikel, dass sich PR relativ autonom als ein "weiteres publizistisches Teilsystem neben dem Journalismus ausprägt". Das Problem ist ja nicht, dass sich Journalismus und PR wechselseitig bedingen und ermöglichen, sondern dass sie sich in bestimmten Bereichen unseres Mediensystems inzwischen durchdringen und verschmelzen. Es geht auch um Interpenetration oder Hybridisierung gelegentlich hin bis zur Unkenntlichkeit von Journalismus.
Sich wechselseitig ermöglichen, dass ist eben nur die halbe Wahrheit, das ist eine Beschönigung und Verharmlosung und auch eine Verschleierung bestehender Zustände. Intereffikation, so möchte ich zuspitzen, ist PR für PR. Es gibt also gute Gründe, in wissenschaftlichen Analysen nicht mit diesem Begriff zu hantieren, zumal er auch eine grenzaufhebende Partnerschaftsideologie zwischen PR und Journalismus insinuiert.
Von Futtertieren und Parasiten
Um die realen Gegebenheiten und deren Entwicklungsdynamik angemessen modellhaft abzubilden, gefällt mir deshalb Joachim Westerbarkeys und Klaus Kocks, Bild einer parasitären Beziehung zwischen Journalismus und PR viel besser. PR ist Kocks zufolge allerdings eine "Kommunikationsdisziplin, die nur in einer publizistisch intakten Landschaft funktioniert". Deshalb sieht er "PR als Parasiten", der "allergrößtes Interesse an der Gesundheit seines Futtertieres " habe. Soll heißen: PR ist nur dann und so lange funktionsfähig, wie auch der Journalismus funktioniert.
Es gibt aber, wie in Baerns Nullsummenspiel angedacht gleichwohl einen fortdauernden Machtkampf zwischen PR und Journalismus. Im Intereffikationsmodell wird dieser dagegen allzu harmonisch weggezaubert. Überwuchert die PR mehr und mehr den Journalismus und gelingt es nicht, sei es durch Selbstkontrolle, sei es durch eine behutsame "Ordnungspolitik", einen Ausgleich, eine Balance herzustellen, so kann das letztendlich für beide und damit auch für die Informations- und Pressefreiheit in der Demokratie tödlich enden.
So einleuchtend die Parasit-Parabel ist, so dringlich scheint mir ein weiteres Gedankenexperiment: Ich möchte Kocks gerne vom Kopf auf die Füße stellen. Sein Modell ist nämlich nicht minder schlüssig, wenn wir es umdrehen. Ist es nicht so, dass in der Medienbranche im Vergleich zu anderen Dienstleistungssektoren besonders hohe Renditen erzielt werden? Und werden nicht trotzdem Redaktionsetats immer mehr zusammengestrichen, während dagegen PR-Stäbe und Agenturen atemberaubend schnell wachsen? Wo möglich werden ja immer mehr der Journalismus und die Medienunternehmen zu Parasiten, von Werbung und PR leben statt umgekehrt.
Die Werbung finanziert weitgehend das Mediengeschäft - zumindestens 50 % bei Zeitschriften, zu etwa 2/3 bei Zeitungen und sogar zu 100 % beim privaten Rundfunk. Obendrein liefern PR-Agenturen und Presseabteilungen, wie wir Dank Barbara Baerns, Bernd Grossenbacher und anderer PR-Forschern seit einigen Jahren wissen, den Großteil aller Nachrichten frei Haus. Und selbst Investitionen in publizistischer Qualität, sprich: in Infrastrukturen wie etwa außerbetriebliche Weiterbildungsprogramme für Journalisten, Journalistenpreise, nicht-kommerzielle Medienforschung, tätigen heute tendenziell eher Unternehmen und Stiftungen, die der Medienbranche fernstehen, als die Medienunternehmen selbst.
Sind also die Parasiten nicht eher die Redaktionen und Medienunternehmen, und die Futtertiere mehr und mehr die PR- und Werbebranche? Dass solch ein Vexierspiel möglich ist, dass sich die Sache drehen und wenden lässt und dass sich beide Seiten sowohl als Parasiten als auch als Futtertiere sehen lassen, sollte nachdenklich stimmen. Ist es nicht vielleicht ein Hinweis darauf, dass es letztlich um ganz reelle Tauschakte geht - so zusagen um ein pareto-optimales Bilderbuch-Geschäft, bei dem sich beide Seiten besser stellen.
Aber worin besteht die Gegenleistung? Sie ist immateriell und trotzdem viel Geld wert, denn sie besteht aus einem besonders knappen Gut: die Medien verleihen Aufmerksamkeit.
Das Problem besteht jedoch genau darin, dass seriöser Journalismus Aufmerksamkeit nicht meistbietend versteigern darf, sondern sie unbestechlich nach seinen eigenen professionellen Kriterien zuteilen muss. Dies leisten zu können, müsste Journalismus mit hinreichender eigener Recherchekapazität agieren können und nicht in Abhängigkeit davon, wie umfangreich und gut die PR-Zulieferungen sind. Tut er das nicht, entsteht ein "externer Effekt": Betrogen werden die Zielgruppen, denen die Medien vorgaukeln, sie lieferten hochwertigen Journalismus, während sie in Wirklichkeit für sie "billige" PR weiter verwerten. Auch so entstehen Glaubwürdigkeitsverluste.
Vielleicht müssen wir trotzdem unsere Hoffnung darauf richten, dass mehr und mehr PR-Praktiker erkennen, wie sehr sie als Futtertiere den Parasiten mit ernähren sollten, weil sie ihn letztendlich brauchen.
Für den Versuch, die Machtverhältnisse zwischen Journalismus und PR wissenschaftlich zu analysieren, eignet sich jedenfalls nach wie vor das Baernssche Ausgangsmodell gut, weil es den Antagonismus zwischen PR und Journalismus akzentuiert. Allerdings sollten wir es der überflüssigen Annahme entkleiden, dass Journalismus irgendein fiktives Gesamtinteresse vertreten könnte. Und wir sollten es ergänzen um die Möglichkeiten, Macht und Einfluss von Journalisten und PR zu mehren oder zu mindern, wenn sich beide Bereiche symbiotisch "inter-effektivieren" oder gegenseitig desavouieren.
PR und Journalismus: Kein Nullsummenspiel
Die Machtverteilung zwischen Journalismus und PR lässt sich mit einem Nullsummenspiel nicht zureichend beschreiben, in dem Journalismus nur auf Kosten von PR oder PR auf Kosten von Journalismus an Einfluss gewinnen können. Es gibt aber nicht nur die symbiotische Win-Win-Situation, sondern es können auch beide Seiten verlieren - wie im Gefangenendilemma der Spieltheorie als vierte Möglichkeit ja ebenfalls vorgesehen. Wörtlich genommen, verbaut uns der Begriff Intereffikation die Möglichkeit, diese vierte Variante überhaupt gedanklich zu registrieren.