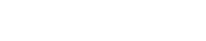Die Phase eines Hypes oder Trends der sozialen Medien geht sicher vorbei, vielfach ist das Web 2.0 zum Alltag geworden und wird disziplinübergreifend organisiert. Für Verbände stellt sich die Frage nach einer vernünftigen und vor allem zielführenden Einbindung der sozialen Medien in die eigene Organisation. Dieser Artikel ist eine Kurzfassung der ausführlichen Analyse „Zehn Feststellungen zu Verbänden und sozialen Medien“ aus dem Praxishandbuch „Social Media in Verbänden“.

Es dürfte mittlerweile feststehen, dass die sozialen Medien keine Bedrohung für Verbände darstellen. Kaum ein Verband wird sich auflösen, wenn seine Mitglieder eine XING-Gruppe gründen, jedoch kann ein solcher Verband die Zufriedenheit ebendieser Mitglieder erhöhen, versteht er es, sich die Instrumente des Web 2.0 nutzbar zu machen und die Initiative im Interesse seiner Mitglieder zu übernehmen. Das beginnt mit der Beschäftigung, welche Instrumente wann sinnvoll eingesetzt werden können, und nimmt Maß am sich ändernden Kommunikationsverhalten der nachwachsenden Generationen. Verbände können soziale Medien sehr gut einsetzen, eigene Prozesse vereinfachen und von der strukturellen Vergleichbarkeit beider Konzepte profitieren. Web 2.0 steht als Schlagwort für interaktive und kollaborative Elemente des Internets. Interaktiv, da in der Regel die Grenze zwischen Nutzer (Leser) und Produzent (Autor) aufgehoben wird. Einer der wesentlichen Vorteile aller Web-2.0-Anwendungen zeichnet sich durch eine leichte, niederschwellige Handhabung aus. Jeder, der will, könnte auch.
Web 2.0 ist keine Technologie, sondern ein Konzept, wie Zusammenarbeit und Zusammenkommunikation durch Instrumente des Internets vereinfacht bzw. erst ermöglicht werden.
Dieser Artikel zeigt in der Kürze auf, in welcher Weise soziale Medien tatsächlich die Arbeit der Informations- und später der Verbands-Branche verändern, welche Rolle Verbände in diesem Zwitscher-Geflecht spielen und spielen können. Dieser Artikel stellt eine Kurzfassung des original im Praxishandbuch „Social Media in Verbänden“ niedergelegten Einführungsartikels dar. Es liegt dort wie hier auf der Hand, dass nicht alles in einem Artikel geleistet werden kann – deswegen das Praxisbuch, das erfolgreiche Beispiele vorstellt und in Anwendungsmöglichkeiten einführt.
Wo Verbände stehen
Doch beginnen wir mit den Verbänden. Nicht nur stehen Verbände für dieses Fachbuch im Fokus der Aufmerksamkeit, auch sind Verbände – zumal als unverzichtbarer Teil einer pluralistischen Gesellschaft – Kommunikations-Akteur und damit Adressat einer einschneidenden Veränderung in der Kommunikationsweise, wie es die sozialen Medien nahelegen. Alles in allem dürften Verbände in Deutschland eine volkswirtschaftlich und schließlich politisch nicht unerhebliche Stellung einnehmen. Seit der Wiedervereinigung hat sich die Anzahl der Verbände in Deutschland stetig erhöht. Schätzungen der DGVM zufolge um etwa fünf Prozent jährlich im Durchschnitt.
Als Organisationseinheiten der Gesellschaft übernehmen Verbände verschiedene Aufgaben in der Gesellschaft, für die Politik und für ihre Mitglieder, beziehungsweise sind als Wirtschaftsverbände (auch) branchenspezifische Dienstleister für ihre Mitgliederunternehmen. Verbände sind mitgliedergesteuerte Organisationen, wobei je nach Verband der Einfluss des einzelnen Mitglieds mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann. Sie sind – rein organisational – damit ein Schmelztiegel der Interessen und Belange ihrer jeweiligen Mitgliedschaft. Diese formiert den Verband, sie ermöglicht seine Existenz und sie determiniert seine Entwicklung.
Verbände stellen einen „außerparlamentarischen Konsensbetrieb“ dar, der teilweise atomisierte Einzelmeinungen hin zum gesellschaftlich relevanten Mittel entwickelt. Horizontal sammeln Verbände Meinungen, Strömungen, Interessen, Belange und vermitteln diese vertikal in verschiedene Ebenen der Gesellschaft.
Verbände bündeln Aufgaben, die sonst dezentral und parallel von verschiedenen Organisationen wahrgenommen werden müssten. Sie rationalisieren dadurch Entscheidungsabläufe und wirken kostensenkend für die jeweilige Branche. Politisch und gesellschaftlich sind Verbände aufgrund ihrer Bündelungsfunktion ein „außerparlamentarischer Konsensbetrieb“, der teilweise atomisierte Einzelmeinungen hin zum gesellschaftlich relevanten Mittel entwickelt. Horizontal sammeln Verbände Meinungen, Strömungen, Interessen, Belange und vermitteln diese vertikal in verschiedene Ebenen der Gesellschaft. Kurz gesagt: Verbände analysieren, vermitteln, organisieren und beraten.
Warum Verbände kommunizieren
Dass all diese relevanten Aufgaben von Verbänden nur wahrgenommen werden können, wenn sie im weiteren Sinne „kommunizieren“, liegt somit auf der Hand. Verbände sind praktizierende Informationsvermittler. Sie vermitteln im Umfeld von Politik, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Branche und Mitgliedern. Sie unterliegen gleichermaßen einem Veränderungsdruck oder -prozess: Die Interessenvertretung ist pluralistischer geworden, mehr und mehr treten zeitlich beschränkte Interessengruppen, Bürger- und Betroffeneninitiativen, Allianzen auf Zeit oder der zeitweise und intensive Einkauf externen Sachverstandes über Agenturen, Kanzleien oder Beratungsunternehmen neben die rein verbandliche Arbeit. Weiter verändert sich die Bindung der Mitglieder zum Verband. Waren zu Beginn der bundesrepublikanischen Erfolgsgeschichte familiäre und unternehmerische Traditionen sehr viel maßgeblicher für den Erwerb und Erhalt der Mitgliedschaftsrechte in einem Verband – „wir waren da schon immer Mitglied und werden das auch bleiben“ –, so finden wir heute selbst bei kleineren Verbänden eine höhere Fluktuation der Mitglieder vor. Schließlich nicht zu verachten: Wir leben in einer „Medienwelt“, in der Kommunikation professionalisiert ist und vielfältigen Anforderungen entsprechen muss, um „gehört“ zu werden.
Besonders die Kommunikations-prozesse unterliegen einem starken Veränderungsdruck, der sich in Bezug auf die Steuerbarkeit äußert: Mehr und mehr unterschiedlichste Empfänger und zunehmend in Konkurrenz zueinander stehende Sender verkomplizieren gezielte Kommunikationsaufgaben. Die „Mitmach-Kommunikation“ der auchnur am Rand Beteiligten macht vor Verbänden nicht halt.
Fassen wir zusammen: Verbände stehen trotz ihrer transparenten Mitgliederstruktur, ihrer klar erkennbaren Interessen und in der Regel damit glaubwürdigen Stellung als Information-Broker von der Seitenlinie unter Druck. Dieser Druck wird – und das kann wohl langfristig auch so bleiben – wenig inhaltlich aufgebaut, sondern wird vor allem prozedural ausgeübt. Das Web 2.0 als Mitmach-Web, die sozialen Medien im Allgemeinen, leben von einem sehr viel höheren Partizipationsgrad als klassische Kommunikation und hierin liegt insbesondere für Verbände, die „offen und ehrlich“ kommunizieren, dennoch aber mit weniger Budget auskommen müssen, eine große Chance! Mitgliederbindung, Anerkennung und Glaubwürdigkeit sind nur die ersten Profiteure sinnvoller, ausgewogener und erfolgreicher Kommunikation mithilfe der Instrumente der sozialen Medien.
Soziale Medien fordern einen höheren Partizipationsgrad als klassische Kommunikation, sodass Verbände ihre schon beteiligende Struktur als mitgliedergesteuerte Organisationen umfangreicher nutzen können: Mitgliederbindung, Anerkennung und Glaubwürdigkeit sind nur die ersten Profiteure sinnvoller, ausgewogener und erfolgreicher Kommunikation mithilfe der Instrumente sozialer Medien.
Das beginnt mit der Beschäftigung, welche Instrumente wann sinnvoll eingesetzt werden können, und nimmt Maß am sich ändernden Kommunikationsverhalten der nachwachsenden Generationen. Des Weiteren werden mitgliedergesteuerte Organisationen kompetente personelle Unterstützung brauchen. Verbände, die dem „Digital Native“ gewissermaßen aufs Maul schauen und von deren alltäglichen Umgang mit der neuen Technik lernen, sie als Antreiber, als Innovator, in die eigene Organisation einbinden, profitieren von den Vorteilen. Dass in dieser Einbindung der – führenden – „Digital Natives“ auch ein finanziell nicht zu unterschätzender Aufwand liegen kann, möchte der Autor nicht unerwähnt lassen. Der Kampf um die besten Köpfe, zumal auf dem Gebiet solcher für Organisationen nicht unwichtiger Schlüsselqualifikationen, artet bereits heute in ein Höher- und Höherbieten aus: Wer gute Qualifikationen nachweisen kann, ist sich eben aufgrund der sehr hohen Kommunikationskompetenz auch um seinen eigenen Wert als Mitarbeiter sehr bewusst. Das treibt, neben der hohen Nachfrage und einem geringeren Angebot, den Preis weiter. Doch Verbände tun gut daran, diese Kompetenz entweder einzukaufen oder zu entwickeln: Eine Studie der Marktbeobachter von Websense zeigt, dass 95 Prozent der Arbeitgeber ihren Mitarbeitern den Zugang zu Web-2.0-Anwendungen ermöglichen, aber lediglich die Hälfte der Befragten tatsächlich in der Lage war, Wikis, YouTube oder Seiten wie Google Documents dem Web 2.0 zuzuordnen. Obwohl 80 Prozent der Befragten meinten, das Unternehmen sei gut gegen Viren und Angriffe von außen geschützt, kontrollierte jedoch nur knapp ein Drittel den Inhalt, den sie von Web-2.0-Diensten beziehen, auf Authentizität, Echtheit oder technische Sauberkeit und verarbeitete diesen teilweise sogar als valide Information weiter. Technische Kontrolle wird erlangt, jedoch werden Informationen für bare Münze genommen. Unabhängig ihrer Quelle.
Die Chance des Mitmach-Webs
Da sind der Tabubruch und die Neuerung: Im Mitmach-Web, dem Internet der sozialen Medien, steuert jeder Inhalte bei, berichtet, ergänzt, kommentiert und kritisiert, fotografiert und bebildert. Die Nachricht emanzipiert sich vom ausschließlichen Gut geschulter Redakteure hin zu einem Kollektivgut. Zur Veröffentlichung bedarf sie keinerlei (journalistischer) Kontrolle und ist nicht mehr auf den einen professionellen Informationsbroker (Presseagentur, Verband) angewiesen. Hier tritt – analog zur kollektiv-enzyklopädischen Wikipedia – die sogenannte Schwarm-intelligenz an die Stelle einzelner Redaktionen.
Kommunikation über soziale Medien ist sowohl eine Mitmach-Kommunikation wie sie direkter zum Empfänger hin orientiert ist. Der typische „Gatekeeper“ oder „Informations-Vermittler“ ist nicht mehr notwendig, wenn alle benötigten Informationen niederhürdig durch jeden Leser eigenständig und schnell erlangt werden (können).
Ein nicht mehr ganz aktuelles, aber interessantes Beispiel für die Bearbeitung eines klar abgegrenzten Themenkomplexes durch eine Vielzahl von Internetnutzern ist das GuttenPlag-Wiki. Dort wurde überprüft, ob und inwieweit in der Doktorarbeit des ehemaligen Bundesministers zu Guttenberg die Kriterien für eine wissenschaftliche Arbeit verletzt wurden. Man kann dazu stehen, wie man möchte, ob die Wikipedia nun mehr oder weniger Fehler als beispielsweise die Encyclopaedia Britannica oder der Brockhaus habe, ob es nun richtig sei, dass Hunderte – keinesfalls nach wissenschaftlicher Qualifikation ausgesuchte – Internetnutzer auf Plagiate-Jagd gehen. Fest steht: Das ist ein Faktum und es findet statt. Keine noch so professionelle Organisation hätte die Ressourcen aufbringen können, mit derselben Schnellig- und Genauigkeit nach Plagiaten zu suchen, wie das dem „grassroots-movement“-GuttenPlag gelang. Was in der Zusammenarbeit („collaboration“) bei Fehlerfinden oder Einträge-Schreiben geht, lässt sich auf Pressearbeit übertragen.
Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Kommunikation im Web 2.0 ist der ausgesprochene Zielgruppen-Bezug und v. a. die Orientierung an der Zielgruppen-Größe. Aus der Masse der Follower, Fans oder Freunde wird Legitimität für die Nachricht und schließlich den Sender abgeleitet. Da kommt es gar nicht immer auf den Inhalt an, solange die Gruppe derjenigen, die eine Nachricht „gut“ finden, groß genug ist. Einige Beispiele haben schon Fakten geschaffen und sich über geltende Regeln hinweggesetzt, indem sie eine große Gruppe „Follower“ motivieren konnten. Was das Bürgerbegehren oder lautstarke Demonstration in der realen Welt, sind die Fangemeinde und ihre Kommentare in der Online-Welt der sozialen Medien. Dadurch, dass mehr und mehr Nutzer, die bisher nur indirekt über professionelle (Massen-)Medien, Agenturen und Radio- oder TV-Sender erreicht wurden, nun in direkter Weise mit dem Sender in Kontakt treten können, wird es dem Sender ermöglicht, die Kommunikation anders als bisher zu beeinflussen. Gleichsam erfordert das eine sorgfältigere und vorsichtigere Planung sowie zielgruppenorientierte Umsetzung von ebendiesem Sender. Nichts ist schneller verloren als die Gunst der Masse. Zwischen dieser äußerst direkten Kommunikation und den sehr viel komplexeren Anforderungen an den Kommunikator liegt das Potenzial der sozialen Medien für Organisationen und Verbände.
Kommunikation und Arbeit mit den sozialen Medien erfordern ein hohes Maß an Zielgruppen-Orientierung und Rücksicht auf die jeweiligen, auch inoffiziell geltenden Gepflogenheiten.
Dass in diesem Spannungsfeld Risiken und Chancen zu finden sein dürften, liegt auf der Hand. Schon bisher dienten Twitter und andere Medien (Facebook, Google+, LinkedIn, StudiVZ machen da keine Ausnahme) oftmals als Seismograf für Stimmungen und Spannungen, schon jetzt beschäftigen sich Verbände und Kommunikationsprofis mit Blogs, Medienbeobachtung und viralem Marketing. Aber es steht auch fest, wenn mehr und mehr direkte Endnutzer auf soziale Medien zurückgreifen und in sozialen Netzwerken aktiv präsent sind, dass soziale Medien Kommunikation beschleunigen. Manchmal mangelt es ihr an Tiefe. Häufig ist Kommunikation damit schlechter zu kontrollieren.
Verbände als Speerspitze der Entwicklung
Schließlich verändert sich das Verhältnis zum klassischen „Gatekeeper“ und trifft neben Agenturen und Redaktionen eins zu eins auch auf Verbände zu, denn sie übernehmen die kommunikative Hoheit in der jeweiligen Branche, im entsprechenden Umfeld oder aus Sicht ihrer Mitglieder. Verbände können an Einfluss verlieren. Jedoch ist dieser – drohende – Bedeutungsverlust weder ein Automatismus noch notwendig. Verbände können auch sehr gut von den sozialen Medien profitieren, sich als Speerspitze der Entwicklung begreifen, eigene (interne und vor allem mitgliederbezogene) Prozesse vereinfachen und von der strukturellen Vergleichbarkeit beider Konzepte profitieren! Mehr und mehr Mitglieder finden sich in den sozialen Medien und begründen ein Nachfrage-Segment nach Web-2.0-Instrumenten. Zusätzlich kommen für die Kommunikation rein praktische Überlegungen hinzu: Auf der einen Seite mag der Ressourceneinsatz für die Umsetzung höher sein als bei der Nichtumsetzung einer Strategie für die sozialen Medien. Eine solche Betrachtung springt zu kurz: Wer auf der einen Seite mehr erreicht, kann auf der anderen Seite Prozesse vereinfachen und Ressourcen einsparen. Das führt, hier mögen US-amerikanische Associations als Beispiel dienen, zu einer flexibleren, preiswerteren und ressourcenschonenderen Arbeit gerade in Organisationen, die durch die Beteiligung mehrerer Stakeholder (Mitglieder) gekennzeichnet sind. Diese zumeist Ehrenamtler lassen sich einfacher (ressourcenschonender) einbinden, das wiederum stärkt das Gefühl, „gebraucht zu werden“, und intensiviert die Loyalität zur Organisation, wovon mittelbar die Mitglieder profitieren, die ebenso enger an die Organisation heranrückten.
Von den Amerikanern lernen, heißt: soziale Medien verstehen und nutzen lernen. Eine Strategie für die sozialen Medien setzt diese nicht nur als Werkzeug zur Kommunikation um, sondern macht sich die strukturellen Vorteile des Konzepts („Zusammenarbeit“) zu Eigen, um Mitglieder wie Mitarbeiter, Teilnehmer oder Gäste stärker zu binden und eine höhere Loyalität zur Organisation zu entwickeln.
Jeder kommt ins Netz
Dabei sind die Amerikaner hier „nur“ Vorreiter. Auch in Europa wächst der Anteil der Web-2.0er: Mehr und mehr Menschen aller Generationen nutzen, vorrangig, die Kommunikationsangebote der unterschiedlichsten sozialen Medien. Nicht nur ist die Anzahl aktiver Nutzer von sozialen Netzwerken – für das Jahr 2010 gemessen – global um 30 Prozent gewachsen. In Europa wurden Wachstumsraten um 100 Prozent nachgewiesen. Im selben Jahr!
Im globalen Vergleich lässt Facebook sämtliche anderen Web-2.0-Plattformen hinter sich: Mit über der Hälfte Anteil am gesamten Besucheraufkommen der untersuchten Plattformen trägt allein Facebook zum globalen Social Network Traffic bei. Auch jene in die Nutzung der Seite investierte Zeit überrascht doch deutlich: Das gemeine Mitglied auf Facebook nutzt die Plattform knapp sechs Stunden durchschnittlich pro Monat, derselbe Durchschnittsnutzer MySpace aber nur knapp eine Stunde pro Monat. Damit liegt aber MySpace immer noch auf Platz zwei der Statistik, die Facebook mit sechsmal mehr Online-Zeit deutlich anführt, wie Nielson Consulting feststellt. Die Zahl der Besucher und Nutzer von Twitter ist in Europa um mehr als 100 Prozent auf 22,5 Millionen gestiegen. Allein im Juni 2010 habe Twitter in Deutschland die Anzahl der eindeutigen Besucher kräftig gegenüber dem Vorjahresmonat um 144 Prozent auf 2,93 Millionen erhöhen können, hat comScore gemessen. Die Statistiker der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen ergänzen noch: „Twitter-Nutzer weichen von den durchschnittlichen Internetnutzern in wesentlichen Punkten ab: Auffallend oft besitzen Twitter-Nutzer eine berufliche Nähe zum Medium Internet und zur öffentlichen Kommunikation. Außerdem haben sie ein relativ großes Interesse an der Nutzung von Nachrichten über das Internet. Netzwerkanalytische Auswertungen lassen erkennen, dass Twitter nicht als soziales Netzwerk zum Knüpfen oder zur Pflege von Kontakten dient, sondern eher als ein Netzwerk zur Verbreitung von Informationen und besonders von Nachrichten betrachtet werden sollte.“ Insgesamt für alle sozialen Netzwerke hat der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) im März 2010 schon 30 Millionen Deutsche ab 14 Jahren als in mindestens einem Netzwerk aktives Mitglied identifiziert, um dort Freundschaften und Kontakte zu pflegen. In der Gruppe der Nutzer von 18 bis 29 Jahren ist der Anteil der „Onliner“ mit 90 Prozent schon sehr hoch. Zur ganzen Wahrheit gehört weiter auch, so hat Pew Internet & American Life Project herausgefunden, dass die Generation 50plus in die sozialen Netzwerke drängt (Abbildung 1). Der Anteil der US-Bürger in der betroffenen Altersgruppe hat sich 2010 von 22 auf 42 Prozent nahezu verdoppelt. Diese Zunahme verbreitert aber auch die Nutzungsintensität der zur Verfügung stehenden Techniken, fanden die Statistiker von Pew heraus: „Während die E-Mail aus der Gunst der Teenager herausfallen könnte, ist sie für die ältere Generation weiterhin das wichtigste Instrument für die Kommunikation“: 92 Prozent der „Onliner“ in dieser Altersgruppe versendet E-Mails.
Fazit
Somit steht auch und besonders für Verbände fest, dass sich die Frage nach einer vernünftigen und vor allem zielführenden Einbindung der sozialen Medien stellt bzw. in näherer Zukunft stellen wird. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. in Düsseldorf schreibt, dass die „Hobby-Lösungen“ mit Praktikanten ausgedient haben. Die Phase eines Hypes oder Trends ist vorbei, Social Media wird zum Alltag und will disziplinübergreifend organisiert werden.“ Über alle Abteilungen und Arbeitsbereiche hinweg, so der BVDW, wird Kommunikation eine zentrale Rolle spielen.
Die Phase eines Hypes oder Trends der sozialen Medien ist vorbei, diese sind vielfach bereits zum Alltag geworden und werden disziplin-übergreifend organisiert.
Die Frage, ob es sinnvoll und zielführend für den jeweiligen Verband ist, auf diese Weise sich die sozialen Medien nutzbar zu machen, wird systematisch angegangen. Der „Next Generation Verband für Next Generation Mitglieder“, wie Detlev Maaß vom IfKom – Ingenieure für Kommunikation e.V. einmal formulierte, nimmt Fahrt auf. Gleichzeitig wird einer der zentralen Bestandteile des Verbandslebens, nämlich die persönlichen Kontakte und Beziehungen zu und zwischen den Verbandsmitgliedern, durch Web-2.0-Technologien vereinfacht und vielfach ergänzt. Informationsaustausch und Wissensvermittlung nach innen werden bereits heute erfolgreich mit Instrumenten des Web 2.0 umgesetzt. Eigene Netzwerkgruppen werden eingerichtet oder der Wissensaustausch mithilfe von Wikis neu organisiert. Auch Fragen des Internetrechts oder des Umgangs mit den sozialen Medien (Stichwort: Social Media Guidelines) werden angegangen und diskutiert. Newsletter und Mitgliederinformationen werden per E-Mail verschickt, interne Mitarbeiter- und Projektblogs, organisationsinterne oder fachgruppenbezogene Wikis an einigen Stellen verwendet, Empfehlungs- oder Bewertungsfunktionalitäten, Social-Bookmarking-Anwendungen oder RSS in die Internetseiten eingebunden.
Diesen Aktivitäten Struktur zu geben und den eigenen Verband langfristig sinnvoll in den sozialen Medien aufzustellen, ist eine der Herausforderungen für den Verbandsmanager, die vielfältige Arbeitsbereiche beeinflusst und die Zusammenarbeit besonders in Personenorganisationen, wie Verbänden, verändern wird. Sie schafft aber neue Handlungsbereiche, bindet Mitglieder enger an den Verband, erhöht die Durchschlagskraft und professionalisiert die Rolle als Informations-Vermittler, so wie sie schließlich auch die Attraktivität des Verbandes für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter erhält.