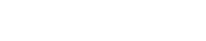Seit es Interessenverbände gibt, wird an sie die Forderung gestellt, die Interessenvertretung auch an das Gemeinwohl zu koppeln. Verbände sollen demnach bei der Wahrnehmung von Interessen zugleich gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Solche Forderungen sind populär, gleichwohl aber nur in einem sehr eingeschränkten Sinn berechtigt.

Jede Gesellschaft ist durch eine Gemengelage teils gegenläufiger, teils paralleler Interessen, teils unversöhnlicher, teils versöhnbarer Gegensätze gekennzeichnet, die sich mehr oder weniger Gehör und Beachtung zu verschaffen trachten. Welche Interessen in welchem Ausmaß schließlich obsiegen, ist Gegenstand eines komplizierten und wenig transparenten gesellschaftlichen Konflikt- und Vermittlungsprozesses, an dem unter anderem Politik, Wirtschaft, Sozialpartner, Medien und zahlreiche andere Institutionen — darunter auch Interessenverbände — beteiligt sind.
Jeder Akteur versucht seine Interessen prinzipiell auf Kosten anderer Interessen durchzusetzen, sofern er nicht aus strategischem oder taktischem Kalkül Allianzen eingegangen ist. Eine relativ stabile Gleichgewichtslage wird der Theorie zufolge hergestellt, wenn sich alle Interessen am Ende zwar nicht optimal, doch aber ausreichend berücksichtigt sehen. Dies nennt man eine Kompromisslage.
Interessenverbände sind Anwälte, keine Richter
Interessenvertreter bei der Wahrnehmung von Interessen auch auf das Gemeinwohl verpflichten zu wollen, verkennt ihre Rolle im Wechselspiel der Interessenvermittlung.
Verbände sind Partei, nicht Richter. Würde man Verbänden die Aufgabe übertragen, sich erst dann zu Wort zu melden, wenn ihnen die Abwägung ihrer Interessen mit der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt gelungen ist, würde man sie überlasten. Aus doppeltem Grund: Niemand kann inhaltlich das Gemeinwohl definieren, einerseits, weil es sich nicht auf die Gegenwart beschränkt, sondern über die „Folgen der Folgen“ weit in die Zukunft reicht und andererseits, weil Privatinteresse und Gemeinwohl nicht — wie in der deutschen Denktradition üblich — als Gegensätze aufgefasst werden sollten. Denn schon Adam Smith hat gezeigt, dass wir täglich frische Brötchen auf unserem Frühstückstisch nicht deshalb finden, weil die Bäcker besonders Gemeinwohl orientiert sind oder einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, sondern wir dürfen hierauf nur deshalb vertrauen, weil sie damit ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse nachkommen.
Zum anderen verkennt die Verpflichtung der Interessenvertretung auf das Gemeinwohl die unterschiedliche Rolle der Akteure. Der Sachverhalt weist insoweit Analogien zu einem Gerichtsverfahren auf: Auch hier ist es nicht Aufgabe des Anwaltes, sich an die Stelle des Gerichts zu setzen, sondern — durchaus parteilich — für das Interesse des Mandanten zu fechten. Seine Aufgabe ist es, diejenigen Gesichtspunkte zu betonen, die der eigenen Partei günstig sind und daher bei dem gerichtlichen Abwägungsprozess berücksichtigt werden sollten. Dagegen ist es nicht Aufgabe des Anwaltes, die eigene Partei mit einem anwaltlichen Schiedsspruch oder Urteil zu entlassen. Im politischen System übernimmt die Politik die Rolle des Gerichts, also derjenigen Instanz, die Interessen bewertet und auswählt und der einen oder anderen Interessenkonstellation den Vorzug gibt. Damit diese Rollenverteilung funktioniert, setzt dies eine autonome Entscheidungsfähigkeit der politischen Sphäre voraus, die also nicht mit illegitimen Mitteln zu einer Entscheidung gedrängt werden darf.
Gemeinwohlorientierung bei Interessenverbänden bedeutet Verfahrensloyalität
Hier beginnt die Gemeinwohlorientierung der Interessenverbände in einem sehr spezifischen Sinn: Sie müssen sich an die Spielregeln halten, dem „Fair Play“ und nicht dem „Foul“ verpflichtet sein. „Fair is foul, and foul is fair“, gehört zu den Todsünden des verbandlichen Selbstverständnisses.
Gemeinwohlorientierung bei Interessenvertretern bedeutet daher Verfahrensorientierung, dagegen nicht die Orientierung an einem wie auch immer inhaltlich verstandenen Gemeinwohlinteresse. Die inhaltlichen Grenzen legitimer Interessenvertretung sind allein durch die Verfassung und die europäische Grundrechtsordnung gezogen. Innerhalb dieser weiten Grenzen ist Interessenvertretung nicht nur legitim, sondern Ferment jeder gesellschaftlichen Fortentwicklung.
Indem Verbände den „due process“ befolgen, der für die Art und Weise der Interessenvertretung durch das jeweilige politische System eröffnet ist, tragen sie bereits dadurch zum Gemeinwohl bei. Denn das Gemeinwohl konstituiert sich nicht in erster Linie in Sachentscheidungen, sondern in einem zivilisierten Verfahren. Auf Dauer ist die Einhaltung von Spielregeln sogar wichtiger als die stets revidierbaren Sachentscheidungen.
Fair-Play-Regeln bei der Interessenvertretung
Was sind denn nun die Regeln des fair Play bei der Interessenvertretung? Der Kanon der Gebote fairer Interessenvertretung lässt sich in wenigen Maximen zusammenfassen:
Zunächst gehört hierzu, mit offenem Visier anzutreten, also die Offenlegung der Interessen und des Vertretungsmandats gegenüber den jeweiligen Gesprächspartnern. Unter falschen Segeln zu kreuzen, ist verbandliche Piraterie und gehört verboten.
Ein administratives Mittel zur Transparenz der Interessenvertretung mag die Registrierung von Interessenvertretern bei Parlament und Verwaltungen sein. Ein Verfahren, das gegenwärtig vor allem auf Brüsseler Ebene diskutiert wird. Verhaltenskodizes mögen eine anderes Mittel sein. Allzu viel erwarten sollte man weder von dem einen noch dem anderen.
Selbstverständlich gehört auf die Tabuliste der verbandlichen Interessenvertretung auch der Verstoß gegen Strafgesetze. Dies ist eine notwendige, allerdings keine hinreichende Bedingung für eine gute und moralisch vertretbare Interessenvertretung.
Im Prinzip muss Interessenvertretung durch die Qualität der Argumente, nicht durch besonders „tiefe Taschen“ gekennzeichnet sein. Jeder Anschein einer individuellen Begünstigung oder Gewährung von Vorteilen für die Verhandlungspartner muss daher strikt vermieden werden.
Bloße Verfahrensloyalität reicht nicht in Autonomiebereichen
Dort, wo Verbänden und Institutionen selbst Gesetzgebungsbefugnisse, also Autonomie, eingeräumt worden ist, reicht zur Legitimität der Interessenvertretung eine bloße Verfahrensloyalität indes nicht aus. Dies gilt nicht nur auf dem Felde der Tarifautonomie, sondern auch im Bereich von Verbändevereinbarungen, die auf Dauer oder vorläufig staatliche Regulierungen ersetzen sollen. Hier können Verbände — wie etwa die Sozialpartner — nicht nur advokatorisch agieren, sondern müssen wegen der verliehenen Autonomie ihre Interessen mit übergeordneten Gemeinwohlinteressen abgleichen. Ansonsten verspielen sie auf Dauer den Kredit für die eingeräumte Autonomie.
Inanspruchnahme von Legitimität auf Kosten der Legalität?
Ob Greenpeace, Attac, radikale Tierschützer, Gentechnikgegner oder Evangelikale: Wer aufgrund seiner Privatphilosophie zu dem Ergebnis gelangt, dass sein Credo absoluten Vorrang vor allen anderen Interessen besitzt, ist schnell bei der Hand, den staatlichen Regelkanon zu verletzen, um im Namen einer höheren Gerechtigkeit die Legitimität seines Vorgehens zu behaupten. Dies trägt zur Erosion einer jeden Rechtsordnung bei und kann daher nicht mit der Verfolgung inhaltlicher Ziele gerechtfertigt werden. Illegales Verhalten im Namen einer höheren Legitimität ist daher kein taugliches Mittel zur Interessenvertretung. Praktikanten dieser Art von Interessenvertretung sollte daher die Registrierung in Brüssel und Berlin versagt werden.