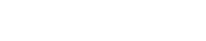Die zweite Hälfte des Jahres 2010 ist in der Öffentlichkeit geprägt von einigen hitzig geführten Debatten. Da ist etwa Thilo Sarrazin mit seinen Thesen zu gelungener oder fehlgeschlagener Integration. Und da ist das Projekt „Stuttgart 21“. An ihm lässt sich eine Erscheinung unserer Zeit besonders gut festmachen: die Entfremdung der Handelnden von den Behandelten. Warum die betroffenen Bürger sich zu Recht hintergangen fühlen und wie dies mit dem Einsatz von Grassroots Campaigning hätte verhindert werden können, zeigt der nachfolgende Beitrag.

Stuttgart soll weder für einen Stausee zur Hälfte geflutet werden noch wird der Flughafen neu gebaut, es soll dort weder Atommüll gelagert werden noch eine Autobahnbrücke die Hügel der Stadt verbinden. Es geht um einen Bahnhof. „Nur“, möchte man hinzufügen. Dieser soll, so der Wille der Deutschen Bahn und der Verkehrsplaner, zukunftsfähig umgestaltet werden. Eigentlich also ein Projekt, an dem man vielleicht die explodierenden Kosten kritisieren kann und muss. Ansonsten aber sollten sich die Planer und Bauherren vor Unterstützung in Politik, Gesellschaft und bei den Bürgern kaum retten können.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Stuttgart 21 ist ein einziges Desaster. Es sind weder Chaoten noch berufsmäßige Umweltaktivisten, die ihrem Protest Ausdruck und Stimme verleihen. Es sind Bürger, Schwaben, CDU-Wähler, es sind Schauspieler, Unternehmer und andere Personen des öffentlichen Lebens. Sie alle gehen auf die Straße, treten vor Fernsehkameras und sitzen in Talkshows. Und es scheint fast so, als würden es täglich mehr. So mancher Befürworter des Projekts erlebt angesichts der Masse und der Mischung der Oppositionellen ein verbales Schleudertrauma: so etwa Ministerpräsident Stefan Mappus, der in einer Hauptnachrichtensendung darauf verwies, dass Entscheidungen über bauen oder nicht bauen das Parlament fälle und nicht die Bürger auf der Straße. Mancher Zuschauer bildete sich ein, ein trotziges Aufstampfen gehört zu haben.
Die Kommunikation ist gescheitert
Blendet man die inhaltlichen Fragen aus, ob ein derartiger Bahnhofsumbau, -ausbau oder teilweiser -neubau sinnvoll ist, ob er in die Zeit passt und ob die veranschlagten Kosten dafür gerechtfertigt sind, dann bleibt ein Kernproblem: die Kommunikation. Oder besser gesagt, die mangelhafte Kommunikation. Der Stadt, dem Land und der Demokratie wären einige Verwerfungen erspart geblieben, wenn es nicht erst des altersweisen Heiner Geißler für die Erkenntnis bedurft hätte, dass die Zeit der „Basta-Entscheidungen“ vorüber sei.
Wer Großprojekte plant, der beobachtet das Geschehen in Politik und Gesellschaft in der Regel sehr genau. Schließlich steht viel Geld auf dem Spiel. Man hätte also durchaus bemerken können, dass die Haltung der Bevölkerung zwischen den Beschlüssen vor fünfzehn Jahren und heute sich gewandelt hat. Und man hätte rechtzeitig reagieren können. Die Möglichkeiten wären da gewesen.
Heute noch eine Gruppe allein ausgerichtet auf die Befürwortung des Projekts Stuttgart 21 formieren zu wollen, ist ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Aber auch weit im Vorfeld hätte dies nicht den gewünschten Effekt gehabt. Ausschließlich auf eine Bewegung „Pro Stuttgart 21“ zu setzen, wäre deutlich zu kurz gesprungen.
Auch wenn viele der sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen ein Interesse an der Umsetzung dieses Projektes haben, so ist es doch die Deutsche Bahn AG, die als Bauherr in der Öffentlichkeit die Flagge hochhalten muss. Sie hat es ja ohnehin nicht leicht in ebendieser Öffentlichkeit; zu viel hat sie in den letzten Monaten auf dem Negativkonto angesammelt: Mal ist der Winter zu kalt und die Züge frieren ein, mal ist der Sommer zu warm und die Klimaanlagen streiken bis zum kollektiven Kollaps. Es ist offensichtlich auch unerheblich, ob Mehdorn oder Grube an der Spitze stehen — mit Vornamen heißen ohnehin beide Bahnchef. Unabhängig von Stuttgart 21 täte die Bahn also gut daran, sich ernsthafte Gedanken um ihre Reputation in der Gesellschaft zu machen.
Rechtzeitig Unterstützung sichern
Um eine Entwicklung wie die aktuelle abzuwenden oder zumindest zu mildern, hätte sich die Bahn schon vor längerer Zeit das Partizipationsprinzip zu eigen machen und eine Gemeinschaft von Unterstützern aufbauen sollen. Die Bahn und diesen Kreis von Menschen muss verbinden, dass sie ein gemeinsames Interesse haben; gemeinsame Themen, die zu einer gemeinsamen Sache werden können. Das könnten etwa die ökologischen Vorteile der Bahn gegenüber anderen Verkehrsmitteln sein wie der geringere Flächenverbrauch oder der Energieverbrauch. Auch Fragen steigenden Komforts oder verbesserter Servicequalität kann so eine Community diskutieren. Die Kommunikation muss dabei immer auf Augenhöhe stattfinden, Belehrungen oder gar das Streichen kritischer Beiträge sind sicher kontraproduktiv. Die Teilnehmer müssen das Gefühl haben, mit ihren Meinungen und Anregungen ernst genommen zu werden, dann besteht auch die Chance, dass sie in anderen Fragen die Meinung der Bahn übernehmen.
Dies darf natürlich nicht platt und billig passieren. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die Unterstützer instrumentalisiert fühlen — das Schlimmste, was einem in dieser Situation passieren kann. Man hätte aber sicher aus den diskutierten Themen und vorherrschenden Meinungen heraus Argumente für den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs finden können. Und man hätte so einen breiteren Konsens schaffen können, denn alle Personen, die sich in einer derartigen Gruppe engagieren, sind auch Meinungsbildner in ihrem direkten persönlichen Umfeld.
Um diesen Personenkreis zu finden und zu binden, bedarf es natürlich einiger Anstrengungen. Wichtigstes Kriterium für ein Engagement ist die Relevanz. Gemeint ist nicht die Relevanz für denjenigen, der die Unterstützung sucht. Es ist die Relevanz für den angesprochenen Personenkreis, die entscheidet. Das muss sehr kritisch beleuchtet werden, denn eine gewisse Betriebsblindheit ist uns allen nicht fremd. Aber was uns bedeutend erscheint, kann für den Nachbarn völlig uninteressant sein. Es müssen dabei „echte“ Themen sein, die Substanz haben und eine inhaltliche Halbwertszeit, die sich nicht nach Tagen bemisst. Grassroots Campaigning eignet sich nicht als Alibiveranstaltung. Nur wenn es einem Initiator gelingt, echte Relevanz zu schaffen, kann er in der -Folge eigene Themen zu gemeinsamen Themen machen. Damit können die Unterstützer dann auch bei Bedarf mobilisiert werden.
Die Gegner schlafen nicht
Natürlich lässt sich ein solches Instrument nicht nur von der einen Seite einsetzen. Auch die Gegner von Stuttgart 21 hätten ihre Position schon längst deutlich verbessern können, wenn sie Grassroots Campaigning konsequent für sich genutzt hätten.
Stellen wir uns folgendes Szenario vor: Nicht erst mit Beginn der Bauarbeiten, sondern bereits im Vorfeld bauen die Gegner von Stuttgart 21 Druck auf. Sie nutzen dazu Plattformen und Argumentationen, die völlig abseits des aktuellen Diskussionsgegenstands liegen und dennoch — oder gerade deshalb — besonders wirkungsvoll sind. Nehmen wir an, ein bedeutender Stuttgarter Einzelhändler fände seine Position latent auf der Seite der Befürworter. Eine größere Zahl seiner Kunden teilt ihm nun mit, künftig in anderen Geschäften einkaufen zu wollen, ändere er diese Haltung nicht. Wie wird er reagieren? Trotzig, wenn er es sich leisten kann oder von der anderen Seite der Druck noch größer ist, oder wankend, weil ihn die Attacke von einer Seite trifft, auf der er keine offene Flanke vermutete.
Dieses Beispiel lässt sich weiterentwickeln und auf eine nächste Stufe bringen: Einige Unternehmer haben durch diese neue Form des Kundenwillens ihre Haltung geändert, andere waren von Anfang an auf der Seite der Gegner. Nun machen sie sich gemeinsam daran, auch ihre etablierten Interessenvertreter von der Industrie- und Handelskammer auf ihre Seite zu ziehen. Würde der Vorstand der IHK durch diesen Druck zu einer geänderten Meinung kommen? Durchaus, wenn er etwa Gefahr laufen würde, bei der nächsten Vorstandswahl sein repräsentatives Amt zu verlieren. Viele Stimmen sind es nicht, die dafür nötig wären, denn deutschlandweit liegt die Wahlbeteiligung bei IHK-Wahlen bei rund fünf Prozent. Da reichen schon wenige meinungsstarke Aktivisten für einen „Putsch-Versuch“.
Wie es ist, mit den Konsequenzen einer Trotzhaltung leben zu müssen, erfährt gerade die CDU in Baden-Württemberg. Sie hat sich weiter entfernt von ihrer ursprünglichen Stammwählerschaft als jemals zuvor in ihrer Geschichte. Dabei wäre es völlig ausreichend gewesen, sich etwas intensiver mit der geänderten Meinung des Volkes zu beschäftigen. Denn ohne hier quantifizieren zu wollen, ob mehr Einwohner des Landes dafür oder dagegen sind — dass es eine relevante Größe sein wird, hat natürlich auch die CDU frühzeitig realisiert. Den nächsten Schritt aber ist sie nicht gegangen: sich zu fragen, wie hoch die Opportunitätskosten sein werden, wenn das Projekt durchgezogen wird. In diesem konkreten Fall bedeutet das, wie hoch die Verluste bei der nächsten Wahl ausfallen werden.
Obama zeigt, wies geht
Was hier an einem uns täglich bewegenden Beispiel aus Deutschland eher theoretisch aufgezeigt wurde, hat praxiserprobte Vorbilder. In manchen Bereichen des Lebens sind uns ja die Amerikaner etwas voraus — so auch hier. Der Wahlsieg Barack Obamas liefert tatsächlich ein Beispiel für gelungenes Grassroots Campaigning. Dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass die politischen Karrieren in Deutschland und den USA gänzlich unterschiedlich angelegt sind. Während Politiker bei uns sich in ihrer Partei in der Regel hochdienen und dann, über die staatliche Parteienfinanzierung alimentiert, in höchste Ämter vorstoßen können, ist Politik in den USA immer mit Geld verbunden. Die Chancen, das Präsidentenamt zu erreichen, steigen also mit der Höhe des (Wahlkampf-)Kontos. Obama verfügte nicht über die Unterstützung der Reichen und Mächtigen. Aber er hatte sich rechtzeitig die Unterstützung vieler Bürger im ganzen Land gesichert. Als diese nun das Geld für den Wahlkampf sammelten, waren die Einzelsummen gering. In der Masse aber schlugen sie die seines Gegners, der von der Industrie unterstützt wurde, um Längen.
Manchmal sind es natürlich auch eher grenzwertige Initiativen, denen die Methodik des Grassroots Campaigning zum Erfolg verhilft. Eine davon ist die Geschichte der Erde, wie sie in einigen Bundesstaaten der USA unterrichtet wird. Mit gezielten Aktionen konnten es einige wenige Initiatoren schaffen, eine große Zahl an Unterstützern für ihr Thema zu finden. Diese „Fundamentalisten“ und ihre Anhänger übten einen derartigen Druck auf die Politik aus, dass es zu Änderungen im Lehrplan kam: In diesen Staaten ist die Evolutionstheorie des Charles Darwin aus den Büchern verschwunden. Allein richtig ist dort, dass die Erde etwa 3000 vor Christus erschaffen wurde — und zwar durch Gott in sechs Tagen.
Wer nicht sät, wird nicht ernten
Wenn wir in der biblischen Bilderwelt bleiben, so wird es den Initiatoren einer Grassroots-Bewegung sicher nicht gehen wie den Vögeln auf dem Feld, bei denen sich der Erfolg ohne Anstrengung einstellt. Nur wer seine Hausaufgaben sehr gründlich erledigt, kann eine erfolgreiche Partizipations-Kampagne initiieren.
Die Aktivierung von Einzelpersonen und Interessengruppen verlangt nach einem ausgeklügelten Management. Basis muss immer eine Idee mit der daraus abgeleiteten Strategie sein. Es müssen schon konkrete Ziele gefasst werden; Initiativen, die sich die Schaffung einer allgemeinen, aber indifferenten positiven Stimmung zum Ziel setzen, sind zum Scheitern verurteilt. Der zweite Teil der Basis sind die technischen und personellen Voraussetzungen. Wenn ich nicht über Personen verfüge, die in sozialen Netzwerken kompetent und schnell Antworten geben können, oder wenn diese nicht wissen, wie weit sie inhaltlich gehen dürfen, dann wird meine Zielgruppe die Kommunikation nicht als eine auf Augenhöhe geführte erfahren. In dieser Phase muss man sich übrigens auch zwingend und intensiv mit Fragen des Datenschutzes beschäftigen. Nichts wäre schädlicher für die Gruppendynamik und auch für die Wirkung in der Öffentlichkeit als Patzer an dieser heiklen Stelle.
Sind die Grundlagen geschaffen, kann man beginnen, die ersten Unterstützer zu gewinnen. Dass dies sinnvollerweise innerhalb der eigenen Organisation oder im direkten Umfeld geschieht, dürfte einleuchten. Das kann aber natürlich nur die Startrampe sein. Schnell müssen die Botschaften über den Rand des eigenen Tellers hinaus kommuniziert werden. Wer jetzt richtig vorbereitet ist, weiß um die Themen, die in der Zielgruppe aktuell relevant sind. Er kann also die Ansprache so gestalten, dass eine durchgängig positive Emotionalisierung stattfindet.
Jetzt heißt es am Ball zu bleiben, Themen zu setzen und zu besetzen, Kompetenz zu zeigen, aber auch Verständnis für andere Meinungen. Wächst die Gruppe der Unterstützer, kommt der nächste Schritt von ganz alleine: Die Öffentlichkeit in ihrer Breite und damit auch die Medien nehmen diese Gruppe als kompetent für ein Thema wahr, im besten Fall sogar als dominant für bestimmte Fragen.
Ab diesem Punkt verhält sich Grassroots Campaigning wie ein Auto auf der Schnellstraße: In der Phase der Beschleunigung wird sehr viel Energie verbraucht. Ist ein bestimmtes Tempo erreicht und muss nur noch gehalten werden, reduziert sich der Einsatz enorm. Das Aktivierungs-Management profitiert von nun an von Erfahrungen und Synergien — die Kampagne wird bis zu einem gewissen Grad zum Selbstläufer.
Dies ergibt sich aus dem Verhalten des Menschen in der Gruppe. Sich für eine Sache zu interessieren ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung, um ein aktives Mitglied zu werden. Entsteht aber ein Heimatgefühl, wird auch nach außen signalisiert: „Ja, ich gehöre dazu.“ Wenn dieses Bekenntnis regelmäßig wiederholt wird, ist der Schritt zur aktiven Partizipation nur noch ein kleiner. In einem letzten Schritt übernehmen die Aktivisten die Initiative. Nach und nach kann sich der Initiator zurückziehen und von einer pushenden und anleitenden Position auf eine beobachtende und moderierende wechseln.
Es ist nie zu spät
Werfen wir noch einen letzten Blick auf Stuttgart 21. Ein Kompromiss ist in dieser Frage natürlich nur schwer zu finden, schließlich kann der Bahnhof nicht halb unter der Erde verschwinden. Allerdings sind auch weder ein generelles Nein und damit ein Negieren der Tatsache, dass man bereits seit rund zwei Jahrzehnten hätte aktiv werden können, noch ein Durchpeitschen des Projekts mit Wasserwerfer und Schlagstock die richtige Lösung. Letztendlich entscheidet in der Demokratie das Volk: sei es demonstrativ auf der Straße, an der Wahlurne — oder eben durch die Beteiligung an Grassroots-Kampagnen.