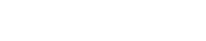Das Angebot an Software für Verbände ist groß. Auch sind die Anforderungen so vielfältig, dass es fast so scheint, als gäbe es für jeden Einsatzort auch eine Lösung. Verbändereport leuchtete den Markt für Verbandssoftware aus. Fazit: Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote, die eines gemeinsam haben – die Orientierung hin zu den durchaus besonderen Anforderungen von Verbänden setzt sich fort. Auch stieg die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Software-Lösungen. Die Zusammenführung von reinen Verwaltungs-Tools mit Instrumenten des „Member Relationship Management“ und Interaktionsmöglichkeiten über Gremiengrenzen hinweg, die bereits vor einigen Jahren begann, bringt Lösungen für Verbände hervor, die in den Geschäftsstellen gute Arbeit leisten können.

Die große Bandbreite der angebotenen Produkte macht es wahrscheinlich, dass die „richtige“ Software für jede Verbandsstruktur und Anforderung dabei ist. Die Kunst liegt darin, genau diese richtige Software für die individuellen Belange zu identifizieren.
Im Idealfall bildet die Verbandssoftware wesentliche Arbeitsprozesse einer Geschäftsstelle ab: von der Mitgliederverwaltung und dem Beitragsinkasso über die Abonnentenverwaltung der Verbandszeitschrift bis zur Seminar- und Veranstaltungsverwaltung. Sie vereinfacht die Kommunikation mit den Mitgliedern, indem sie beispielsweise Ausschüssen und Gremien nach vordefinierten Kriterien Dokumente zur Verfügung stellt, diese in einem internen Mitgliederbereich ablegt oder auch Teile des Internetauftritts des Verbandes pflegt. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Das bedeutet aber, dass mit steigender Komplexität des Systems auch die Sorgfalt der Auswahl in den Mittelpunkt rückt. Fehlentscheidungen bedingen einen hohen Korrekturaufwand und sind kostenintensiv.
Selbermachen oder „Machen lassen“
Bei jeder Software-Implementierung stehen zwei Wege offen: Selbermachen oder „machen lassen“. Mit zunehmendem Projektfortschritt entfernen sich beide Wege voneinander: Bei einer hochspezifischen „Insellösung“ für die sehr konkrete Lage in einer Organisation stellt der notwendige Einarbeitungsaufwand externer Berater und Techniker eine Hürde dar. Diese ist umso höher, je länger das System läuft, Anpassungen am laufenden System vorgenommen wurden und Prozesse innerhalb der Geschäftsstelle sich an die Erfordernisse angepasst haben. Auf der anderen Seite: Insellösung bedeutet im Idealfall auch effektive Lösung.
Schon an diesem Punkt wird eines deutlich: Die Krux in der Software-Auswahl liegt weniger in der Auswahl der technischen Lösung oder der Identifikation des präferierten Anbieters, vielmehr spielt der menschliche Faktor eine sehr entscheidende Rolle. Es sind die Mitarbeiter, die mit der Software umgehen müssen, es sind dieselben Mitarbeiter, die hilfreich mit Tipps und Erfahrungswerten zur Seite stehen können, es sind auch genau diese Mitarbeiter, die aus einer perfekten Lösung eine Investitionsruine machen können, wenn sie die Nutzung verweigern.
Zusammenarbeit von Anfang an
Eine solche „Verweigerungshaltung“, so destruktiv sie sein kann, stellen wir regelmäßig fest. Sie gründet nicht allein auf persönlichen Vorbehalten, sondern sehr viel häufiger stehen grundsätzliche Missverständnisse und das Gefühl, „nicht gefragt worden zu sein“ im Weg. Software-Implementierung ist zuallererst Führungsaufgabe. Es menschelt eben. Genau hierin liegt das Potenzial einer erfolgreichen Einführung. Zielorientierte und respektvolle Einbindung aller beteiligten Mitarbeiter sowohl in die Entscheidungs- wie auch in die Entwicklungs-Prozesse wirkt quasi katalytisch auf Motivation, Anerkennung und Akzeptanz. Der Ansatz eines effizienten Zusammenarbeitens, das Freiheiten schafft und Verantwortung einfordert, klingt zuerst aufwendig und zeitraubend. Wenn die Grenzen und Kompetenzen klar definiert sind, werden sie anerkannt. So wird Partizipation zum Schmelztiegel guter Ideen, sinnvoller Ergänzungen und positiv kritischer Bewertungen. Diese Offenheit beschleunigt nicht nur die Einführung, sondern bildet die Basis des Erfolgs.
Der Weg, eine neue Software in der Geschäftsstelle einzuführen, beginnt folglich mit einer sogenannten Umfeld-Analyse. Ein paar Eckdaten aus unserer Erfahrung mögen dabei hilfreich sein: Es gibt einen relevanten Unterschied zwischen Mitarbeiterzeit und Kalenderzeit. Fünf Mitarbeitertage, eine Arbeitswoche, sind kalendarisch mit fünf Arbeitstagen zu jeweils etwa acht Stunden bemessen. Wenn Zeitpläne auf dieser Basis entwickelt werden, vernachlässigt dies die Sicht der Mitarbeiter. Für sie gelten subjektiv andere Zeiten. Eine Woche besteht aus vier Tagen, dieser jeweils aus sechs Stunden. Im besten Fall. Eine von der Projektleitung mit fünf vollen Arbeitstagen projektierte Aufgabe endet nicht am Freitag, wenn sie montags begonnen wurde. Sondern am Donnerstag der Folgewoche!
Leitfragen, die das Umfeld der Organisation erkunden und bedacht werden, sollten daher sein:
- Wie strukturiert sich die interne Organisation?
- Wie ist das technische Umfeld?
- Welche Personen sind beteiligt?
- Wie groß ist das Projekt?
- Wie lange wird das Projekt dauern?
Bereits diese kurzen Einsichten machen deutlich, wie wichtig ein ganzheitliches Herangehen an die Einführung einer -neuen Software-Umgebung ist, das früher greift als mit der technischen Bewertung. Ob die neue Software sich kompatibel in die bestehende Infrastruktur einpasst, ist eine technisch notwendige Frage. Ob die Software zu den Prozessen in der Geschäftsstelle und zu den Mitarbeitern passt, ist strategisch relevant.
In sieben Schritten zur Software
Der Auswahlprozess einer geeigneten Verbandssoftware gliedert sich in sieben Phasen: von der Orientierung über die Erfassung des Istzustandes bis hin zum Sollzustand.
1. Orientieren
Je transparenter dieser Vorgang, desto besser: Oftmals sind Anforderungen an eine Softwarelösung gewissermaßen „versteckt“ – wer regelmäßig von unterwegs auf die Mitgliederdaten und Terminkalender zugreifen möchte oder beispielsweise eine möglichst nahtlose Anbindung mobiler Arbeitsplätze (Laptop, Handheld, Smartphone) nutzen möchte, ist nicht immer auch Hauptansprechpartner für die Pflege der Mitgliederdaten in der Geschäftsstelle. Sich im Umfeld zu orientieren, hilft spätere Fallstricke zu vermeiden und unpraktische Lösungsansätze bereits von Beginn an zu verhindern.
Um den komplexen Auswahlprozess auf der Entscheidungsebene möglichst schlank zu halten, sind klare Verantwortlichkeiten zu bestimmen und alle Beteiligten ab diesem Schritt regelmäßig einzubinden. Sinnvollerweise sollte sich die Beteiligung nicht nur an der Budgethoheit festmachen, sondern auch den konkreten Einsatz berücksichtigen. Zumal regelmäßige Konsultationen der betroffenen Mitarbeiter schon zu Beginn der Einführung das Akzeptanzniveau erhöhen.
2. Untersuchen
Spätestens in diesem Schritt werden notwendige Schwerpunkte der Verbandssoftware (Mitgliederverwaltung, Kontaktmanagement (CRM), FiBu, Anbindung Webseite, Warenwirtschaft, Dokumentenmanagement etc.) identifiziert und Ausschlusskriterien formuliert.
3. Funktionen beschreiben
In welche bestehenden Systeme und Arbeitsabläufe soll die Verbandssoftware eingebunden werden? Welche Strukturen des Verbandes sollen überhaupt abgebildet werden? Es wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, eine Software zu implementieren, deren wesentliche Aufgabe in der detaillierten Ausdifferenzierung von Landes- und Bundesebenen, vielfältigen Gremien und Ausschüssen besteht, wenn eine derartige Tiefe nicht erforderlich ist. Schließlich werden Geschäftsprozesse analysiert, um sicherzustellen, dass das vorhandene Personal den Einsatz als Mittel zur Vereinfachung der bestehenden Arbeitsabläufe erkennt und die Einsatzhürde gering ist.
An dieser Stelle kristallisiert sich eine Funktionsübersicht heraus – geordnet nach Prioritäten werden Anforderungen niedergelegt, die erarbeiteten Lösungen beschrieben und mit den Beteiligten abgestimmt. Diese technische und organisatorische Fundierung bildet die Basis des Pflichtenheftes.
4. Designen
Inwieweit ist die Softwarelösung durch Mitarbeiter in der Geschäftsstelle bedienbar? Nicht zu unterschätzen ist dieser Punkt. Die beste Lösung verfehlt ihr Ziel, wenn die Bedienmasken unübersichtlich sind, wichtige Handgriffe durch unzählige Mausklicks voneinander entfernt liegen oder gar eine unlogische Bedienerführung den Spaß an der Lösung nimmt. Das Hauptaugenmerk sollte dabei immer auf dem Grundsatz liegen: Das Werkzeug passt sich der Aufgabe und dem Nutzer an. Niemals der Nutzer dem Werkzeug.
5. Entwickeln
Die mittlerweile gewonnenen Informationen fließen in ein sogenanntes Pflichtenheft, siehe Kasten auf Seite 17, welches transparent die Anforderungen an die Verbandssoftware dar- sowie die technischen Möglichkeiten und Gegebenheiten der Geschäftsstelle vorstellt. Vom Aufbau eines Pflichtenheftes hängt nicht unwesentlich die genaue Beschreibung der Pflichten für den Softwareanbieter ab. Übersichtlichkeit und klare Strukturierung erhöhen die Vergleichbarkeit der Ergebnisse.
Ähnlich einem klassischen Bewerbungsverfahren zur Besetzung offener Stellen treffen die Verantwortlichen anhand formaler Kriterien aus den Rückmeldungen eine Auswahl von etwa fünf Anbietern. Deren Angebote erfüllen sowohl formale Anforderungen (Erfüllung Grundanforderungen, Abdeckung weiterer Anforderungen, Anpassungsaufwand, erste Kostenschätzung) wie auch inhaltlich die Eckdaten des Pflichtenheftes. Dieser engere Anbieterkreis wird schließlich um die Abgabe eines detaillierten (kaufmännischen) Angebotes gebeten. Unter Umständen liegt ein aktualisiertes Pflichtenheft vor, welches Basis des Angebotes ist. Gerade in dieser Phase ist ein konformes Pflichtenheft unerlässlich – gegliedert nach klaren Kriterien erfasst es beides: den Ist- und den Sollzustand. Die Brücke zwischen Weg und Ziel schlägt im Idealfall genau ein Angebot der Software-Anbieter.
6. Einführen
Ob es sich um eine Software-Lösung à la carte handelt oder umfangreiche und spezifische Anpassungen eine maßgeschneiderte Lösung hervorbringen, die Einführungsphase ist geprägt von ständigem Auf und Ab. Keine Software ist bei Lieferung oder Installation einsatzbereit. Der Einführungsschritt stellt sicher, dass aus technischer Sicht alle Anforderungen abgearbeitet und umgesetzt sind. Vorläufiger Schlusspunkt der Einführung bildet die Endabnahme, die sinnvollerweise nach einer Schulung und Eingewöhnungsphase vorgenommen wird.
7. Erfahrungen aufarbeiten
Nicht klar von der tatsächlichen Einführung zu differenzieren, stellt der letzte Schritt, die reflektive Phase, einen wichtigen Grundsatz dar: Wenn alle Beteiligten mit der neuen Software-Lösung arbeiten, die Mitarbeiter in der Nutzung versiert sind, ergeben sich häufig Änderungswünsche, die in der Planung nicht antizipiert wurden. Häufig auch gar nicht hätten bedacht werden können, da umfangreiche Konzepte ein Stück weit „Chaospotenzial“ in sich bergen. Nie läuft immer alles so wie erwartet, technische Hürden oder Inkompatibilitäten versalzen die Suppe. Hier – vor der Endabnahme – gegensteuern zu können, aus der Praxis zu lernen, wieder auf die Beteiligten zurückzugreifen und Fehlentwicklungen zu korrigieren, macht den letzten Schritt einer erfolgreichen Software-Einführung aus.Diese sieben Projektschritte finden jederzeit Anwendung – sei es, dass technische Kompetenz im Verband vorhanden ist und eine Eigenlösung programmiert oder auf die professionelle Unterstützung eines Anbieters zurückgegriffen wird. Letztlich unterscheiden sich beide Wege nur in der Ausgestaltung. (TR)